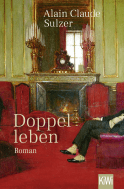Ein Gespräch mit Edmond de Goncourt*
Edmond de Goncourt, der ältere der berühmten Schriftstellerbrüder, im Gespräch über »Blitzlichter«, die von Anita Albus zusammengestellte und übersetzte Auswahl aus dem legendären, berüchtigten Tagebuch der Goncourts.

Wir treffen Edmond de Goncourt, einen freundlichen weißhaarigen Herrn mittleren Alters, im bayerischen Schliersee, wo er sich bei einem Verwandten aufhält, zu einem Gespräch über die Tagebücher, die er bis zu dessen Tod gemeinsam mit seinem Bruder Jules verfasste.
Monsieur de Goncourt, wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrem bereits im Alter von 39 Jahren verstorbenen Bruder Jules beschreiben? Dem Vernehmen nach waren Sie unzertrennlich und teilten alles miteinander.
Ja, das stimmt, wir teilten alles, das Haus, die Arbeit, manchmal sogar die Geliebte. Es gab nichts Trennendes zwischen uns, nur Verbindendes. Wir waren wie ein einziges Ich, so wie ein Ehepaar sein sollte, aber nur selten ist. Wir haben uns nie widersprochen, weil wir beide wie einer dachten, in gewisser Weise herrschten bei uns ewige Flitterwochen. Ich liebte meinen Bruder, und ich denke noch heute fast jeden Augenblick an ihn. Wir waren neugierig auf alles und begierig darauf, alles aufzuschreiben, was wir sahen und hörten. Wir beobachteten und interpretierten, was wir sahen, nicht wie zwei, sondern wie einer. Wir waren wie die Erweiterung eines einzelnen Ichs. Wir empfanden das als ganz natürlichen Zustand.
In Ihrem berühmt-berüchtigten Tagebuch gewähren Sie ungeschönte, teils skandalöse Einblicke in die Welt der Pariser Kunst- und Literaturszene und auch den Hof von Napoléon III. Zur Veröffentlichung war das alles eigentlich nie bestimmt – oder?
Als wir 1851, am Tag, an dem Napoléon III. durch einen Staatsstreich an die Macht gelangte, damit begannen, täglich Tagebuch zu führen, dachten wir noch nicht daran. Aber spätestens nach dem Tod meines Bruders reifte die Idee, die Leser an unseren Beobachtungen teilhaben zu lassen. Warum sollten wir der Nachwelt vorenthalten, was wir gesehen und gehört hatten? Wir hatten allerdings nicht an unsere Zeitgenossen gedacht, denen es sauer aufstieß, dass wir öffentlich machten, was wir ihnen, also der Wirklichkeit, abgelauscht hatten. Als mein Bruder Jules, der bis zu diesem Zeitpunkt bei unserer gemeinsamen Arbeit stets die Feder geführt hatte, im Januar 1870 zu schreiben aufhörte, dachte ich nicht einmal daran, sein Werk fortzuführen. Dann aber tat ich es doch. Ich wollte seinem Leiden ein Denkmal setzen. Ich habe seither nicht mehr aufgehört. Zwei Jahre nach dem Tod meines Bruders erschien dann eine erste redigierte Fassung der Tagebücher.
Was bedeutet »redigiert«?
Das bedeutet, dass ich mit Rücksicht auf meine Freunde, von denen ja die meisten noch lebten, aber auch aus Rücksicht auf deren Familien, manche heikle Passagen unterdrückte. Diese mussten vorerst darauf warten, veröffentlicht zu werden. Manche meiner Freunde waren dennoch sehr erbittert, als sie lasen, was Jules und ich über sie geschrieben hatten. Sie fühlten sich durch uns verraten. Dabei hatten wir nur aufgeschrieben, was wir mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hatten. Wir haben nichts erfunden! Wir haben unangenehme Entwicklungen, die wir beobachteten, nicht verschwiegen. Niemals aber haben wir absichtlich auf Kosten derer, über die wir schrieben, gelogen. Nie! Was nicht heißt, dass wir nicht manchmal ungerecht waren. Aber wer ist das nicht?
Ihre eigene Haushälterin Rose führte viele Jahre ein geheimes, dramatisches Doppelleben, von dem Sie erst nach Roses Tod erfuhren. Wie haben Sie diese Erschütterung verarbeitet?
So wie es Schriftstellern wie uns geziemt. Nachdem wir über die Enthüllungen zunächst schockiert waren, haben wir uns schnell gefangen und einen Roman, an dem wir gerade arbeiteten, beiseite gelegt. Stattdessen haben wir einen Roman über Rose geschrieben, der unter dem Titel Germinie Lacerteux erschien und auf teils heftige Ablehnung stieß. Manche Leser waren empört, dass wir eine Magd ins Zentrum eines literarischen Werks gestellt hatten, gerade so, als sei eine Vertreterin des niederen Stands es nicht wert, porträtiert zu werden.
Sie gehen in den Kreisen der Pariser Boheme ein und aus. Sehen Sie sich selbst als Schriftsteller als einen aktiven Teil dieser Welt oder ist sie Ihnen eigentlich fremd und Sie empfinden sich eher als Beobachter und Chronisten?
Wir waren in erster Linie Schriftsteller und damit Teil der Welt, über die wir schrieben. Dass wir Chronisten dieser Welt wurden, begann als Zufall; schnell wurde es aber zu einer Leidenschaft, alles zu notieren, was uns begegnete. Jeden Abend zusammenzufassen, was der vergangene Tag gebracht hatte, verlangt natürlich eine gewisse Disziplin - die nicht jeder aufbringt. Aber wem außer Schriftstellern wie uns hätte das gelingen können? Man musste auch hier das richtige Wort finden, um wiederzugeben, was man empfand!
Würden Sie – statt im 19. Jahrhundert – in unserer Gegenwart leben, könnten Sie all die ungeschminkten Einblicke und unverblümten Lästereien auch bei Facebook und Co. veröffentlichen. Können Sie sich das vorstellen: die Brüder Goncourt sozusagen als Hybrid aus Schriftsteller und Society-Reporter, immer auf der Jagd nach der nächsten Enthüllung?
Absolut nicht! Wir würden ja von den Betroffenen mit Recht sofort blockiert. Niemand würde sich in unserer Gegenwart getrauen, irgendetwas zu sagen, aus Furcht, tags darauf in den sozialen Medien zitiert zu werden. Wir haben zwanzig Jahre gewartet, bis wir mit unseren Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gingen; die Betroffenen haben es uns nicht gedankt, obwohl sich der Sturm der Entrüstung schnell wieder gelegt hat.
In Ihrem Tagebuch schonen Sie auch enge Vertraute nicht, etwa Flaubert, über den Sie schreiben, er sei »im Grunde provinziell und ein Effekthascher.« Ist Ihre Lust am Lästern so groß, dass sie selbst vor Freunden nicht Halt macht?
Dass wir »gelästert« hätten, ist eine oft gemachte Unterstellung. Ebenso, dass es uns Freude bereitet hätte, über andere herzuziehen. Tatsächlich haben wir immer begründet, wie wir zu unserer Einschätzung kamen. Wir wollten unsere Epoche ungeschönt und in allen Einzelheiten festhalten, wie wir sie sahen, ohne falsche Bescheidenheit und ohne Rücksichtnahme. Ich behaupte nicht, dass wir dabei immer Recht hatten. Wenn wir es für angebracht hielten, haben wir unser Urteil revidiert. Äußerste Ehrlichkeit war immer unser Bestreben, beim Tagebuchschreiben wie beim Verfassen von Romanen.
* Die Fragen beantwortete, stellvertretend für Edmond de Goncourt, Goncourt-Spezialist Alain Claude Sulzer, der sich die letzten Jahre in die Brüder hineinversetzt und gerade den viel gelobten Roman Doppelleben (siehe unten) über sie veröffentlicht hat.
Eine brillante Auswahl aus dem berühmt-berüchtigten Tagebuch der Brüder Goncourt, »Erste-Sahne-Klatsch« (Gerd Haffmans) vom Feinsten.
»Ein Gehirn, das mit vier Händen schrieb« nannte Alain Claude Sulzer einmal die beiden Brüder Goncourt – sie lebten ihr gesamtes Leben lang unter demselben Dach, sie trafen zusammen die Pariser Bohème, sie teilten selbst die Geliebte. Vor allem aber schrieben sie zusammen ihr gefürchtetes Tagebuch. Dort notierten sie alles, was sie sahen, was gesagt wurde, was geschah; auch jeden Fauxpas, jede Peinlichkeit, jedes Gerücht und jede Intimität. Denn: Sie wollten die ungeschminkte Wahrheit. Manche Zeitgenossen mieden die Brüder, weil sie nicht in diesem Tagebuch landen wollten. Daraus veröffentlichte Auszüge sorgten für Skandale. Und erst 1956 konnte es erstmals unzensiert erscheinen. Sicherheitshalber in Monaco, außerhalb der französischen Gesetzgebung.
Die von Anita Albus großartig übersetzte und zusammengestellte Auswahl verspricht gehörigen Lesespaß. Wir begegnen allen (Geistes-)Größen des gesellschaftlichen Lebens Frankreichs: Baudelaire (»Der Kopf eines Verrückten, die Stimme wie eine Klinge«), Sarah Bernhardt (»die Wohnungseinrichtung in plump orientalischem Geschmack«), Flaubert (»von de Sade besessen. Glücklich, wenn er einen Kloakenfeger sieht, der Kot frisst … im Grunde provinziell und ein Effekthascher«), Hugo (»von heftigem Priapismus befallen«), Napoleon III. (»automatenhaft, somnambul, mit dem Auge einer Echse, die zu schlafen scheint, aber nicht schläft«), George Sand (»ganz entschieden eine geniale Null«), Fürst Metternich (»dieser missratene Affe«) und und und. Ein eminent lesenswerter Blick auf die Pariser Szene!